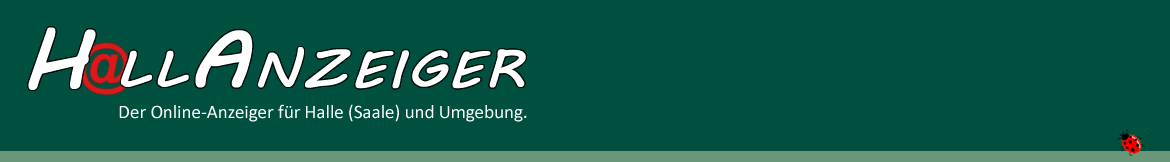Halle/UMH. Für viele Frauen gehören starke Regelschmerzen zum Alltag. Oft werden die Beschwerden verharmlost, doch hinter ihnen kann eine ernstzunehmende medizinische Ursache stecken: Endometriose zählt zu den häufigsten, aber oft übersehenen gynäkologischen Krankheitsbildern.
In Deutschland leben schätzungsweise zwei Millionen Menschen mit der chronischen Erkrankung, doch die Diagnose dauert häufig Jahre. Bei Endometriose siedelt sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter an, beispielsweise an den Eierstöcken, den Eileitern oder der Blase.
Dadurch entstehen Entzündungen und Verwachsungen, die starke Schmerzen verursachen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Um aufzuklären, Verständnis zu schaffen und neue Behandlungswege vorzustellen, lädt die Universitätsklinik und Poliklinik für Gynäkologie der Universitätsmedizin Halle am 05. November 2025 zu einer offenen Gesprächsrunde ein.
Im Austausch werden Symptome, Diagnostik und Therapieformen der Endometriose beleuchtet – ebenso die Frage, warum Forschung entscheidend ist, um betroffenen Frauen besser zu helfen.
Termin:
Mittwoch, 5. November 2025, 18.00 – 19.30 Uhr
Ort:
Mitarbeitenden-Restaurant, Haus 17, Etage E02
Ernst-Grube-Straße 40, 06120 Halle (Saale)
Online:
Live-Stream über YouTube – zum Stream
(Tipp: Im angelegten Livestream lässt sich eine Erinnerung aktivieren.)
Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich!
Mit dabei:
- Prof. Dr. Markus Wallwiener, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Gynäkologie und Endometriose-Experte
- eine betroffene Patientin, die offen über ihren Alltag spricht
- Moderatorin Sabine Oehlrich
Ein Schwerpunkt des Abends liegt auf dem Forschungsprojekt „ENDO-EVE: Endometriose effektiv erkennen und koordiniert ganzheitlich therapieren“. Unter Leitung der Universitätsmedizin Halle arbeitet ein interdisziplinäres Konsortium daran, die Versorgung von Frauen mit Endometriose nachhaltig zu verbessern. Ziel ist es, Diagnosezeiten deutlich zu verkürzen, Behandlungsqualität zu steigern und Patientinnen mit digitalen Begleitangeboten zu unterstützen. Das Projekt wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert und entwickelt unter anderem ein strukturiertes Diagnostikprogramm sowie eine App, die Betroffene durch alle Phasen der Behandlung begleitet.